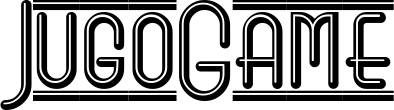Ridley Scott kehrt mit einem weiteren Alien-Prequel nach „Prometheus“ aus dem Jahr 2012 zurück. Hier ist unsere spoilerfreie Rezension von Alien: Covenant…
Bitte beachten Sie: Diese Rezension enthält einen leichten Spoiler, der bereits in der Werbung für den Film enthüllt wurde. Aber markieren Sie es einfach hier, falls Sie es bisher geschafft haben, alles zu vermeiden.
Prometheus war vieles, aber eines der Dinge, bei denen es sich selten wie ein Alien-Film anfühlte. In mancher Hinsicht war dies positiv; Anstatt eine reine Neuinterpretation seines Hits von 1979 anzubieten, ging Regisseur Ridley Scott einen anderen Weg – er erweiterte das Alien-Universum mit Geschichten über die Ursprünge der Menschheit und alten Göttern auf der anderen Seite der Galaxie. Es gab schlüpfende Monster und Momente psycho-___ueller Bedrohung, aber das Biest aus „Alien“ war nirgendwo zu sehen.
„Alien: Covenant“ hingegen scheint eine Art Reaktion auf die Kritik an Prometheus zu sein. Zum einen handelt es sich um ein direkteres Prequel zu „Alien“ – der Beweis findet sich direkt im Titel – und es wird weniger Zeit damit verbracht, über die Beweggründe hinter einer Rasse von acht Fuß großen, gottähnlichen Außerirdischen nachzudenken, sondern mehr Zeit damit, aus Angst vor Kreaturen davonzulaufen mit großen Zähnen und Krallen.
Ein Jahrzehnt nach den Ereignissen von Prometheus macht sich ein weiteres Weyland-Yutani-Schiff auf den Weg in die Tiefen des Weltraums. Diesmal ist es die Covenant – ein Schiff, das dazu bestimmt ist, eine neue Kolonie auf einem fernen, erdähnlichen Planeten namens Origae-6 zu gründen. Neben der Besatzung, die das Schiff steuert – darunter der Terraforming-Experte Daniels (Katherine Waterston), der Weltraum-Cowboy Tennessee (Danny McBride) und der etwas ineffiziente Anführer Oram (Billy Crudup) – gibt es eine Ladung von rund 2.000 tiefgefrorenen Kolonisten, deren Aufgabe es sein wird hinauszugehen und ihre neue Welt zu bevölkern. Doch eine Kette von Ereignissen führt bald dazu, dass die Allianz ihren Kurs auf einen anderen Planeten ändert, der ebenfalls erdähnlich ist, aber dieser ist die Heimat des abtrünnigen synthetischen David (Michael Fassbender, zurück von seinen Possen in Prometheus) und vielleicht eines oder zweier Monster.
Wir müssen es gleich zugeben: Schon im Vorspann haben wir „Alien: Covenant“ angefeuert. „Prometheus“ hatte seine Probleme, doch „Der Marsianer“, Scotts hervorragende Adaption des Romans von Andy Weir aus dem Jahr 2015, bewies, dass der Regisseur mit einem soliden Drehbuch immer noch einen äußerst spannenden Science-Fiction-Film auf die Beine stellen konnte. Wenn „Alien: Covenant“ diesem Beispiel folgen könnte, dachten wir, und Scott seine visuelle Magie aus einem Drehbuch von John Logan und Dante Harper (anstelle von „Jon Spaihts“ und „Damon Lindelof“ von Prometheus) weben würde, dann könnten wir am Ende vielleicht etwas bekommen, das dieser Brillanz zumindest nahe kommt des genreprägenden Alien.
In der ersten Stunde enttäuscht Alien: Covenant nicht. Zu den Klängen von Jed Kurzels Musik, die sowohl die rauen Töne von Jerry Goldsmiths klassischer Filmmusik überarbeitet als auch ihre eigenen pochenden, beunruhigenden Melodien hinzufügt, erschafft Scott eine vertraute, aber intensive Geschichte über Erkundung, Überleben und schlängelnde Albträume. Die Covenant ist ein viel eckigeres, handwerklicheres Schiff als die Prometheus; immer noch voller Gadgets und holografischer Displays, aber näher am „Ölbohrinsel im Weltraum“-Feeling des Nostromo. Die Covenant hat sogar ihre eigene Mutter (oder MU-TH-UR 6000) – die künstliche Intelligenz, die das Schiff in Alien gesteuert hat.
Das Erfreulichste an der ersten Hälfte von „Alien: Covenant“ ist jedoch, dass die Schiffsbesatzung ein natürlicher wirkender Haufen ist als der neurotische Haufen, der in Prometheus herumstolperte. Ihre Dialoge und Interaktionen wirken zurückhaltend und ungezwungen, wobei der Text hier das erdige, halb improvisierte Gefühl von Alien widerspiegelt. Insbesondere Katherine Waterston ist hervorragend als Daniels, der Terraforming-Experte und Planetenforscher des Schiffes; Zwischen ihrer Figur und McBrides Tennessee, der seine Rolle völlig geradlinig spielt, herrscht eine tolle Chemie – wer befürchtet, er könnte dem Covenant eine aufgezwungene Komik verleihen, kann beruhigt sein.
Die Probleme von „Alien: Covenant“ werden erst in der zweiten Hälfte deutlich. Auch wenn der Film nicht so an Kohärenz verliert wie Prometheus, dringt die Geschichte doch in ein ähnlich heikles, leicht kitschiges Erzählgebiet vor. Eines der Themen ist überraschenderweise Michael Fassbender, der hier zwei Rollen spielt. Neben David tritt der Schauspieler auch als Walter auf, ein neueres synthetisches Modell mit weniger Persönlichkeitsstörungen als sein Vorgänger.
Walter ist ein durchaus sympathischer Charakter – er hat einen Hauch der traurigen Zurückhaltung von Bishop in „Aliens“ –, aber Fassbenders Versuch, einen amerikanischen Akzent zu setzen, wird ihm wahrscheinlich nicht viele Auszeichnungen einbringen. Während er als David an der Reihe ist, wird ihm eine unerwartet dicke Scheibe Schinken serviert; Der Androide, der zum verrückten Wissenschaftler geworden ist, verhält sich jetzt wie Vincent Price in einer der alten Edgar-Allan-Poe-Adaptionen von Roger Corman und schwebt mit einer Passage romantischer Poesie oder einem unangenehmen Einzeiler auf den Lippen in die Schatten und wieder heraus.
Glücklicherweise hat „Alien: Covenant“ in der Action-Horror-Abteilung immer noch das, worauf es ankommt. Einige der Handlungsentwicklungen überzeugen vielleicht nicht unbedingt, aber das Tempo ist großartig – sobald die Dinge auf dem Planeten Paradise erst einmal nach Süden gehen, geht es mit erstaunlicher Geschwindigkeit nach Süden. Wir wollen die Sache nicht verderben, indem wir im Detail über die Monster sprechen (die Trailer haben bereits mehr verraten, als uns lieb war), aber die Ereignisse in Covenant sind weitaus dramatischer und beunruhigender als in Prometheus.
Alien: Covenant ist daher kein perfektes Exemplar. Aber in der inzwischen recht großen Reihe von Alien-Filmen – die vier Hauptfilme, zwei Prequels und zwei Spin-offs umfasst – gehört Covenant immer noch zu den besseren. Kein Klassiker wie „Alien“ oder „Aliens“, aber weniger kompromisslos als „Alien 3“, weniger albern als „Alien: Resurrection“ oder die schwächeren Momente von „Prometheus“ und in einer ganzen Liga besser als das ziemlich schreckliche „Aliens gegen Predator: Requiem“.
Das Titelmonster mag heutzutage zu vertraut sein, um uns wirklich Angst einzujagen, aber „Alien: Covenant“ hat dennoch mehr als nur ein paar Momente, um den Puls höher zu schlagen und das Blut zu stillen.
Außerirdischer: Bund kommt am 12. Mai in die britischen Kinos.
Auch, Alien: Fluss des Schmerzes ist jetzt auf Audible verfügbar. Erfahren Sie hier mehr und erhalten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion.
Sehen Sie sich die Geburt des Androiden in Alien: Covenant an
Supergirl Staffel 4 Episode 1 Rezension: American Alien
Alien: Blackout-Rezension: Ein Handyspiel, das sein Geld wert ist
Buchrezension „Alien: Out of the Shadows“.
Die besten und schlechtesten Filme über Alien-Entführungen
Alien: River Of Pain – Einführung in ein spannendes Hörspiel; neuer Trailer
Wie Ron Perlman den Alien: Resurrection Basketball Shot beinahe ruiniert hätte
William Gibsons Alien III: Space Commies in Mallworld
Sehen Sie sich die erste Folge unseres Alien-Dating-Spiels an!
Captive State Review: Der Film „Alien Occupation“ hat keinen Zweck
Die Serie „Alien Highway“ fängt außerirdischen Verkehr ein
Warum Sie Alien und Ghostbusters wieder im Kino erleben sollten